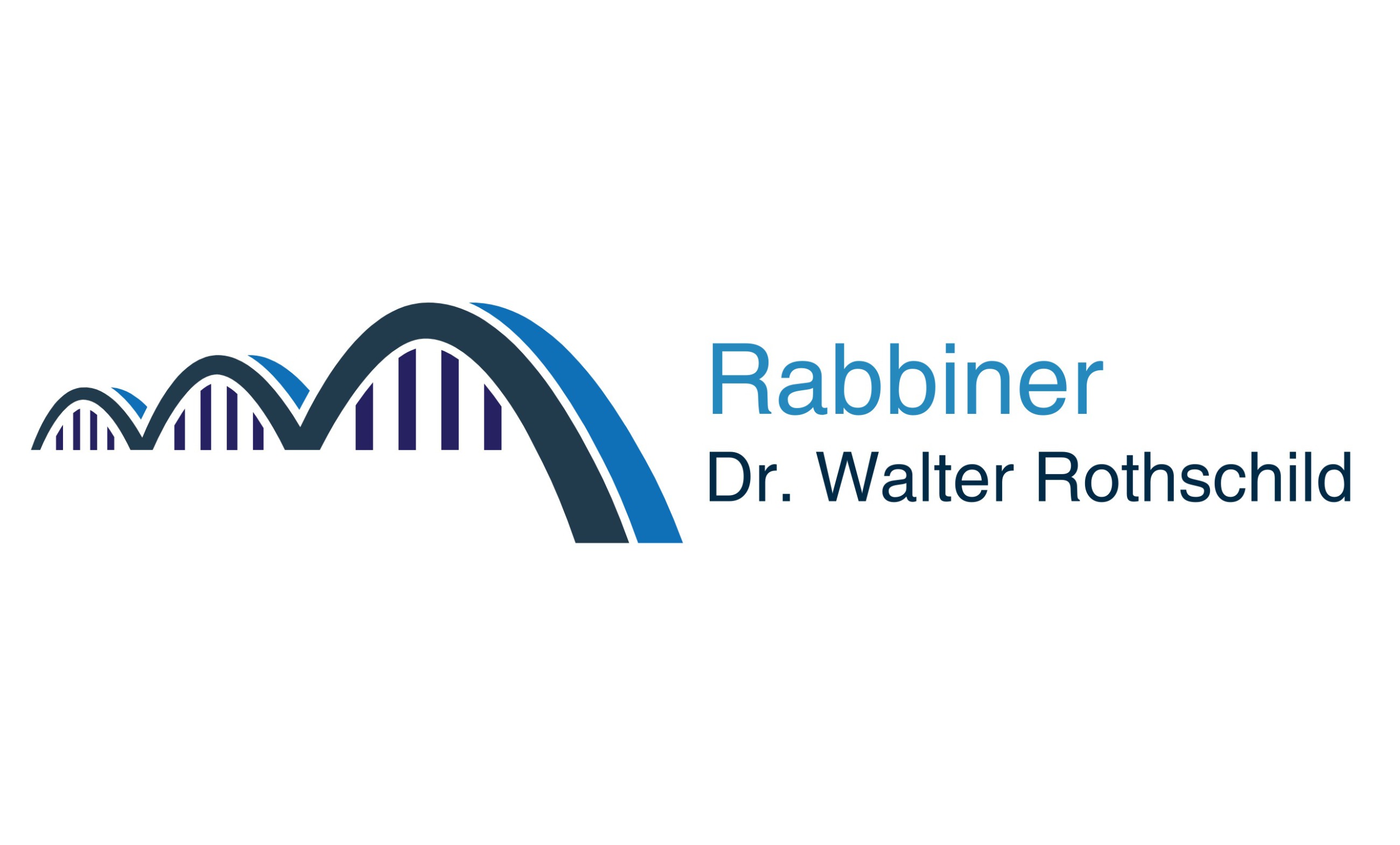Eine Mahnung vor Zeugen
"Ha'asinu"
(Höret)
Deuteronomium / 5. Buch Mose 32:1 -32:52
Es ist gezockt worden. Um schnell reich zu werden wurde jedes Gespür für Verantwortung außer Acht gelassen. Anleger, Finanzmakler und Investmentbanker verursachten großes Unheil – nicht nur für die Weltwirtschaft, sondern auch für die öffentlichen Haushalte der Staaten und die Portmonees ihrer Bürger. Das ist nicht nur eine ökonomische und soziale, sondern auch eine ethische Katastrophe. Und es ist nicht die erste in der Geschichte der Menschheit.
Man hätte es vorhersehen können, so könnte man diesen Wochenabschnitt lesen. Dort ist natürlich nicht von der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahre 2009 die Rede, sondern von der Gefahr, Götzen zu verfallen. Das Volk ist groß geworden; Gott will es warnen. Es ist ihm bitterernst damit. Die Israeliten sind in Aufbruchstimmung und erwarten bessere Zeiten.
Mosche [1] singt einen Psalm. Er ist ein letztes Mal die Stimme seines Herrn: "Merk auf, O Himmel, ich will reden! Die Erde höre meines Mundes Wort!"[2]. Auf Hebräisch: "Ha'asinu haSchamajim weAdabera! WeTischma haAretz Imre-Phi!" Es sind Worte aus inbrünstigem Gotteslob und wütender Kritik an seinen Leuten: " Sie sind ein Volk, das jeder Einsicht bar, in ihrer Mitte waltet nicht Vernunft."( 'Ki-Goj ovad Eytzot heyma, W'Eyn bahem Tewuna.)[3]. Der Text mündet in eine Drohung: "Ich töte, ich belebe, ich schlage und ich heile, und niemand kann aus meiner Hand erretten."[4]
Einige Verse zuvor, erzählt die Tora eine Vorgeschichte. Gott hat Mosche und Joschua[5] ins Stiftszelt bestellt. Er konfrontiert sie mit einer Prognose: Sobald die Kinder Israels den Jordan überquert haben und sie in dem Land angekommen sein werden, „das von Milch und Honig fließt“, werde das widerspenstige Volk dick und träge werden und den Göttern des Landes anhängen. Es werde den Bund mit seinem Gott vergessen, und deshalb Leiden und Drangsal erfahren.
Für solche Vergesslichkeit lagen bereits Erfahrungen vor. Den Vätern und Großvätern der künftigen Siedler war entfallen, dass sie mit Mizraim auch das Sklavenhaus verlassen hatten. Das versprochene Land von Milch und Honig schien ihnen ziemlich weit entfernt. Sie wollten schneller „reich“ werden und verklärten deshalb das Land von Fisch, Gurken und Knoblauch[6], das hinter ihnen lag.
Gott fordert Demut. Die Israeliten sollten sich erinnern, wer sie errettet hatte, wer sie durch die Wüste führte, wem Liebe und Loyalität gebühren. Dafür diktiert er Mosche dieses Lied, berichtet die Tora. Es ist eine Art Merkhilfe und dient ihm als „Zeuge gegen die Kinder Israels"[7]. Und der „lehrte es die Kinder Israels"[8], ja, er trägt es schließlich „der ganzen Gemeinde Israel ... bis zu Ende"[9] vor.
Und was war am Anfang? „Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde"[10] – in dem er sprach. Danach aber handelt die Tora stets von den Problemen Erde. Doch hier, gegen Ende der Tora schließt sich der Kreis. Himmel und Erde sollen in seinem letzten Lied hören was Mosche in Gottes Auftrag zu sagen oder zu singen hat[11]. Als die Israeliten durch das Schilfmeer gezogen waren, Ägypten verlassen und die rettende Wüste erreichten hatten, jubelte er ein Siegeslied. Er pries den Ewigen[12]; und jetzt, wo sie endlich diese Wüste verlassen können und in das Land Israel einziehen sollen, erinnert sie dieser leidenschaftlich-drohende Abschiedsgesang an die Vergangenheit.
Reim und Rhythmus in Gedichten und Liedern helfen, sich etwas präzise merken zu können. Die Melodie kennen wir nicht mehr. Gab es überhaupt eine? Auf jeden Fall ist es kein Triumphgeschrei und auch kein religiöses Liebeslied. Es ist eine Mahnung. Ein Psalm, dessen Wahrheit zu lesen und zu singen wenig Freude bereitet. Vielleicht ist deshalb in unserer Liturgie viel weniger davon erhalten als man erwarten sollte; eigentlich nur ein Satz und ein Halbsatz. Im Toragottesdienst singen wir „Ki Schem Adonai Ekra, havu Godel L'eyloheynu"[13] Auf Deutsch: „Des Ewigen Namen will ich künden, O, gebt unserem Gott die Ehre!“. Und bei Beerdigungen sprechen wir „Ein Fels ist er, sein Tun vollkommen“ (HaTzur, Tamim Pa'alo). Immerhin: Am Ende der Liturgie, kurz bevor wir nach Hause und in unseren Alltag zurückkehren, singen wir das Alenu. Im traditionellen Siddur enthält es die Bitte darum, dass „die Anbetung der Götzen aufhört“. Der Liberale formuliert aktueller, „dass die Anbetung des Geldes von der Erde verschwindet“.
[1]
Mose [2] Dewarim/Deuteronomium
32:1 [3] Dewarim/Dtn. 32:28
[4] Dewarim/Dtn. 32:39 [5] Josua
[6] Bemidbar/Numeri 11:5 (gemeint ist Ägypten)
[7] Dewarim/Dtn. 31:19 [8] Dewarim/Dtn. 31:22 [9] Dewarim/Dtn. 31:10
[10] Bereschit/Genesis 1:1 [11] Dewarim/Dtn.
32:1 [12] Schemot/Exodus 15:1-20
[13] Seder haTefillot, JVB Berlin 2001, S.104 unten (Dieser hebräische Text wird in der deutschen Version auf der gegenüber liegenden Seite 105
nicht übersetzt wiedergegeben)