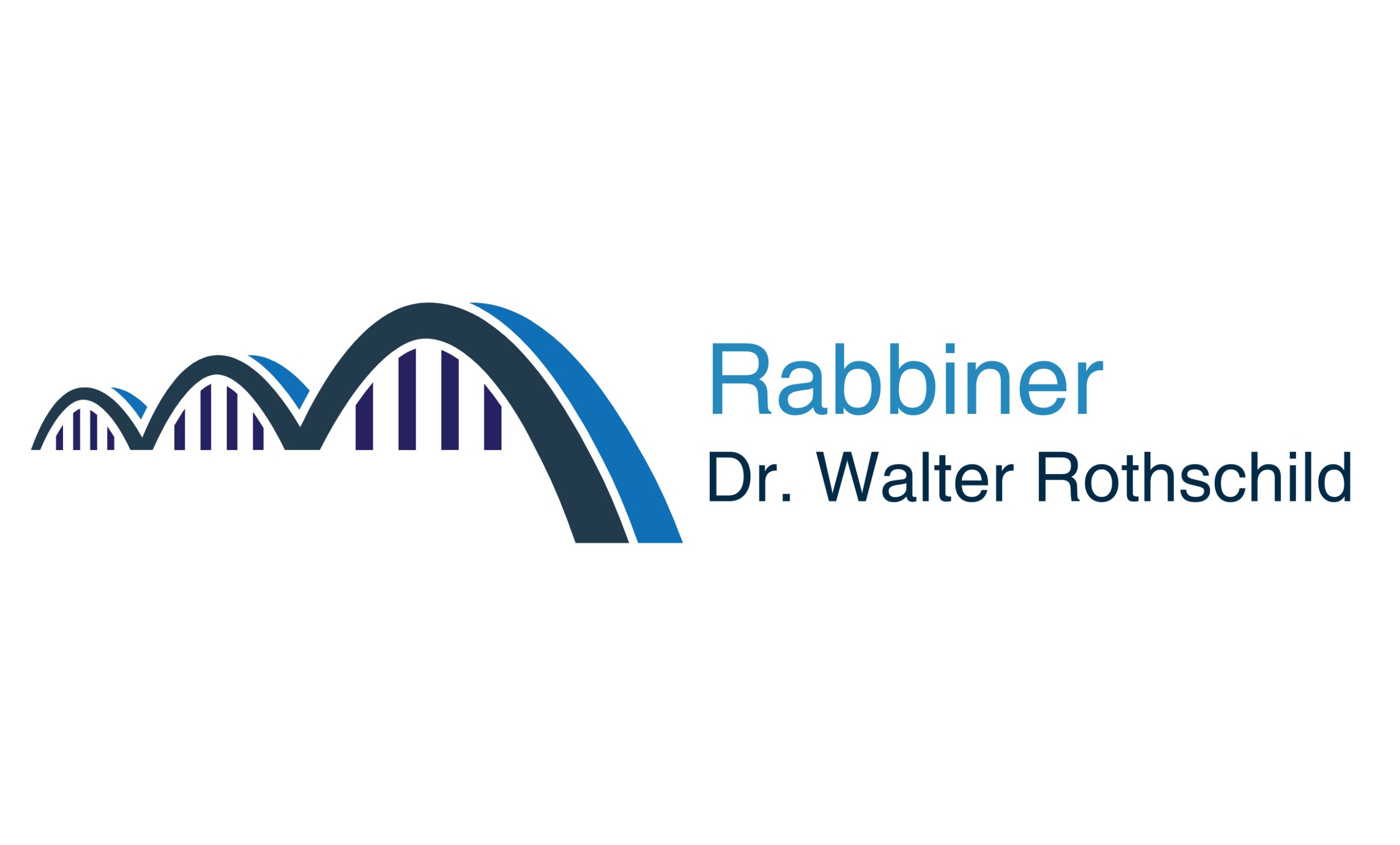Vom Heiligen und den Spesen.
"Emor"
(Rede)
Levitkus / 3. Buch Mose 21:1 - 24:23
"Kein gewöhnlicher Mensch soll etwas Heiliges essen“, gebietet die Tora [1]. Eine irritierende Anweisung. Welches Gericht, welches Tier, welches Gemüse ist für sich genommen heilig? Was ist heilig überhaupt? Das Wort hat in unserem Kulturkreis einen magischen Klang. Ist es etwas ehrfurchtgebietend Göttliches? Etwas, das uns zu Recht einen „heiligen“ Schauer über den Rücken jagt?
Schon die nächsten Sätze lassen uns ahnen, dass wir mit dieser gefühlten Heiligkeit auf die falsche Fährte geraten sind. Hier wird ganz formal unterschieden: „Der Hausdiener eines Priesters und der Lohndiener sollen nichts Heiliges essen. Wenn aber ein Priester eine Person für Geld gekauft hat, so kann sie davon essen. Auch in seinem Haus geborene Sklaven können von seiner Speise mitessen."[2] Weiter steht dort, dass selbst die Tochter eines Priesters, wenn sie „einen gewöhnlichen Menschen heiratet"[3], von der gemeinsamen Speise ausgeschlossen wird. Sollte sie aber verwitwet oder geschieden sein und in das Haus ihres Vaters zurückgekehrt sein, dann zählt sie wieder zum Haushalt und darf von „ihres Vaters Speise essen"[4].
Das klingt nun vollends befremdlich; und doch lässt sich diese Art der Differenzierung einfach erklären: Dem Stamm der Leviten, der die Priester stellte, war bei der Aufteilung des Landes kein Gebiet zugewiesen worden. Seine Mitglieder erhielten eine besondere Aufgabe: Sie sollten von den Opfern leben, die im Tempel erbracht wurden.[5] Diese Opfer sind heilig: Sie repräsentieren das Besondere, dass dem Alltäglichen, dem Profanen gegenüber steht. Den Priestern stand als Einkommen in der Regel nur ein Anteil am Heiligen zu. Deshalb war es nötig zu klären, wer so abhängig von ihnen ist, dass er oder sie sich ebenfalls von diesen Spenden für das Tempelopfer ernähren dürfen.
Nehmen wir Beispiele aus der Gegenwart: Wenn ich Spesen für eine Dienstreise erstattet bekomme, kann ich dann einfach die Kosten für meine Ehefrau, meinen Freund, andere Bekannte oder meine Kinder auf die Rechnung setzen, nur weil sie mich begleitet haben? Wenn ich zu einer Konferenz eingeladen werde, darf ich dann jemand mitnehmen und dem Veranstalter die Kosten aufhalsen? Darf jemand, der eine Dienstwohnung bewohnt, andere einladen, dort zu wohnen und gar noch Geld für die Untermiete nehmen? Wenn mein Unternehmen oder mein Auftraggeber wirtschaftlich gut dasteht, werden ihn die Kosten für das Sandwich der Ehefrau oder das Doppelzimmer nicht bankrott gehen lassen. Aber ist das überhaupt eine ökonomische Frage? Ist es nicht schon eine moralische?
Wer darf „Sonderleistungen“ und Privilegien nutzen? Dafür braucht man Regeln. Die sind besonders wichtig, wenn man für eine karitative Organisation arbeitet, die von Spenden lebt. Die Menschen erwarten, dass ihre Gelder so eingesetzt werden, dass sie dem „guten Zweck“ optimal dienen und nicht für einen unangemessenen Verwaltungsapparat ausgegeben werden oder dafür, dass sich die Chefs mit ihren Begleitungen am Pool von Luxushotels vergnügen.
Das führt uns wieder auf unseren Text zurück: Die Israeliten gingen zum Tempel und lieferten ihre Opfer in Form von Lebensmitteln ab: Tiere, Mehl, Olivenöl, Gemüse oder Obst. Ein Teil war für Gott bestimmt und wurde als Rauchopfer verbrannt; in manchen Fällen ging sogar etwas an die Spender zurück; ein dritter Teil aber gehörte der Priesterschaft. Und das war die Regel: Wer zum Haushalt des Priesters gehörte, die Ehefrau, seine Kinder und Sklaven, durften daran teilhaben. Hatten sie die Familie verlassen, um Teil einer anderen zu werden, durften sie an den Einnahmen der Priester nicht mehr teilhaben. Kehrten sie zurück gehörten sie wieder dazu. So einfach ist das!
Viele meinen, diese Details im täglichen Ablauf des Tempeldiensts seien langweilig. Ich nicht. Sicher, unsere Sprache hat sich geändert und auch unsere Liturgie – unser Opfer ist das Gebet. Aber wir können trotzdem davon lernen. Menschen bleiben Menschen und Organisationen bleiben Organisationen. Manchmal muss man eben nur länger in die alten Texte hineinschauen, um zu verstehen, das vieles durchaus aktuell und noch immer relevant ist.